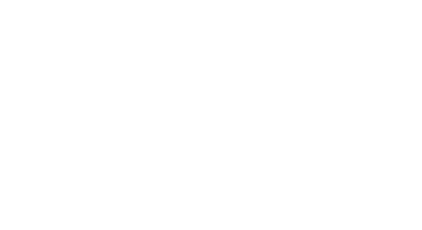Richtig dübeln, schrauben, nageln und sägen
Inhalt
Haus & Garten 3/2001
01.06.2001
Auch beim Werken gilt: Mit Gefühl und Verstand arbeiten. Denn der richtige Umgang mit Werkzeugen und Materialien ist nicht nur Voraussetzung für gute Arbeitsergebnisse, sondern auch für die Verhütung von Unfällen.
So machen Sie Nägel mit Köpfen
- Im Handel sind auf jedem Set Nägel Stärke und Länge abgekürzt angegeben: 2,5x55 heisst: 2,5 mm dick und 55 mm lang, ausserdem sind die Artikelbezeichnung, die Verarbeitung und die Kopfform auf der Packung vermerk...
Auch beim Werken gilt: Mit Gefühl und Verstand arbeiten. Denn der richtige Umgang mit Werkzeugen und Materialien ist nicht nur Voraussetzung für gute Arbeitsergebnisse, sondern auch für die Verhütung von Unfällen.
So machen Sie Nägel mit Köpfen
- Im Handel sind auf jedem Set Nägel Stärke und Länge abgekürzt angegeben: 2,5x55 heisst: 2,5 mm dick und 55 mm lang, ausserdem sind die Artikelbezeichnung, die Verarbeitung und die Kopfform auf der Packung vermerkt.
- Drahtstifte oder Schreinernägel verwenden Sie für einfache Holzverbindungen.
- Gebläute Stahlnägel brauchen Sie, wenn Sie etwas Schweres wie ein Bild aufhängen wollen oder die Wand sehr hart ist.
- Tapezierstifte benötigen Sie, wenn Sie Materialien wie Folien oder Stoffe befestigen möchten.
- Uförmige Agraffen: Zwei Spitzen sind ihr Kennzeichen. Damit können Sie vorwiegend Draht an Holz befestigen und festklemmen.
Wie Sie zwei Holzteile zusammennageln
- Achten Sie bei der Wahl des Nagels darauf, dass etwa 2?3 der Schaftlänge des Nagels in das untere Holz eindringen können.
Achtung: Im Randbereich von dünnen Leisten und Brettern spalten Nägel oft das Holz auf. Verhindern können Sie das, indem Sie die Nagelspitze mit dem Hammer leicht abstumpfen.
- Schauen Sie beim Nageln nicht auf den Hammer, sondern auf den Nagelkopf, sonst ist Ihr Daumen der Leidtragende.
Tipps und Tricks
Kleine Nägel, die sich mit dem Finger nicht halten lassen, können Sie in einen Streifen Karton stecken oder mit einer Haarnadel fixieren und sie dann mit ein paar leichten Schlägen einschlagen.
Genagelte Verbindungen werden stabiler, wenn Sie die Nägel schräg gegeneinander setzen.
Schlagen Sie das letzte Stück des Nagels mit einem Versenker ein, um Hammerschlagspuren auf dem Holz zu vermeiden.
Einen Nagel herausziehen
Nehmen Sie die Beisszange und legen Sie unter die untere Zangenbacke ein kleines Holzstück, so verhindern Sie eine unschöne Delle im Werkstück.
Schrauben, die nicht lockerlassen
Schraubenverbindungen haben gegenüber einer Nagelung einen doppelten Vorteil: Sie halten besser und sind trotzdem leichter zu lösen. Doch auch hier gilt: Nur die richtige Schraube bringts.
- Jede Schraube ist durch zwei Zahlen gekennzeichnet, zum Beispiel 4x30 mm. Die erste Zahl gibt in Millimeter an, wie breit der Schraubenschaft unter dem Kopf ist; die zweite die reine Nutz- oder Schaftlänge.
- Die traditionelle Holzschraube hat ein sich zur Spitze hin verjüngendes Gewinde. In der Regel erfordern diese Schrauben ein Vorbohren. Der Durchmesser des Bohrers sollte dabei um 1 mm geringer sein als die Schraubenschaftbreite.
- Spanplattenschrauben lassen sich dagegen ohne Vorbohren direkt versenken.
- Maschinen-, Schloss- oder Gewindeschrauben sind metrische Schrauben, die ein Gegengewinde, also eine Mutter, brauchen. Bei diesen Schrauben verjüngt sich der Schaft nicht, er ist überall gleich stark. Die Schraube wird entweder durch ein Gewindeloch oder durch Teile, die sie verbinden soll, durchgesteckt und nach Einlegen einer Unterlegscheibe mit der Mutter verschraubt.
Welcher Schraubenzieher passt?
- Herkömmliche Schrauben besitzen einen Schlitzkopf oder einen Kreuzschlitz als Antriebsprofil für einen Schraubenzieher. Daneben haben sich weitere Profile etabliert: Pozidriv, die Weiterentwicklung des Kreuzschlitzes, und Torx.
- Die richtige Grösse des Schraubenziehers müssen Sie durch Ausprobieren herausfinden. Passt er, sitzt er satt im Schlitz, und im Idealfall ist die Spitze gleich breit wie der Schraubenkopf. Achtung: Mit einem nicht passenden Werkzeug beschädigen Sie unter Umständen die Schraube und das Werkstück.
Klebstoffe für dauerhafte Verbindungen
Auch ein «Alleskleber» löst nicht alle Klebeprobleme. Je nachdem, ob Sie eine Holzverbindung leimen, eine Vase flicken oder Metall zusammenkleben möchten, benötigen Sie einen Spezialklebstoff. Grundsätzlich kann man die Klebstoffe in zwei Kategorien einteilen, in (Holz-)Leim und Kleber wie 2-Komponenten-, Sofort- und Kontaktkleber.
- Holzleim ist gebrauchsfertig, mit hoher Bindefestigkeit, geeignet für alle üblichen Holzarten und Holzwerkstoffe.
- Sofortkleber: Dieser Kleber ist bereits nach wenigen Sekunden ausgehärtet. Korrekturen sind danach nicht mehr möglich. Dafür lassen sich Materialien wie Kunststoffe, Acryl, Metall und Glas kleben - Materialien, bei denen andere Kleber versagen.
- Kontaktkleber: Er empfiehlt sich, wenn man beispielsweise eine Kunststoffschicht auf eine Holzplatte kleben will.
- 2-Komponenten-Kleber: Sie bestehen aus einem Binder und einem Härter in zwei separaten Tuben. Sie müssen kurz vor der Anwendung - in der Regel im Verhältnis 1:1 - verrührt werden. Sie eignen sich für luftundurchlässige, dichte Materialien und sorgen für extrem beanspruchbare Verklebungen.
So hält der Leim bombenfest
- Reinigen Sie die Klebestelle, entfernen Sie alte Anstriche, alte Klebstoffrückstände oder Fremdstoffe wie Staub, Rost oder Schmutz.
- Entfetten Sie die Klebestelle falls erforderlich mit Alkohol oder mit Verdünner - diese Stellen danach nicht mehr anfassen.
- Tragen Sie den Kleber nach den Anweisungen des Herstellers auf (ein- oder beidseitig). Achten Sie speziell auf die Antrocknungszeit - die Zeit, die nach dem Kleber-Auftrag verstreichen muss, bevor Sie die beiden Teile zusammenpressen dürfen.
Sicherer Umgang mit Klebern
- Machen Sie keine Mischungsexperimente.
- Verwenden Sie lösemittelhaltige Klebstoffe nur in gut belüfteten Räumen. Ob ein Kleber Lösungsmittel enthält, sehen Sie daran, dass der frische Kleber trüb oder klar ist. Trübe oder milchig aussehende Kleber enthalten in der Regel keine Lösungsmittel. Weitere Hinweise stehen auf der Packung.
- Vermeiden Sie bei Klebern mit Lösungsmitteln unbedingt den Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten.
- Bewahren Sie Klebstoffe immer ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
Sägen für einen guten Schnitt
Trotz vielfältiger elektrischer Helfer sind Handsägen in der Heimwerker-Ausrüstung unersetzlich. Die vielseitigste Säge ist der Fuchsschwanz.
Spannen Sie vor dem Sägen das Werkstück fest ein, so dass es beim Sägen weder verrutschen noch federn kann und Sie beide Hände frei zum Arbeiten haben.
- Zeichnen Sie die Schnittlinien so ein, dass sie deutlich erkennbar sind.
- Beginnen Sie immer mit Rückziehen und halten Sie die Säge gut fest. Beim Vorstossen hüpft das Blatt gern vom Riss und nicht selten in den Zeigefinger der haltenden Hand.
- Die Säge in langen, rhythmischen Zügen führen, nutzen Sie dabei die volle Blattlänge aus. Je weniger Druck Sie ausüben, desto weniger weicht der Schnitt von der Sägelinie ab; nur bei der Vorwärtsbewegung etwas Druck geben.
- Das abzusägende Stück sollten Sie abstützen, damit die Enden nicht abbrechen. Achten Sie aber darauf, dass Sie das Stück nicht anheben, sonst klemmen Sie das Sägeblatt ein. Tipp: Um ein Klemmen zu verhindern, stecken Sie einen kleinen Keil in den Sägeschnitt.
- Kontrollieren Sie beim Sägen ständig, ob die Schnittlinie noch stimmt.
So bohren und dübeln Sie ohne Probleme
Das grosse Angebot an Bohrmaschinen lässt sich auf drei Typen reduzieren: netzunabhängige Akku-Bohrmaschinen, die jedoch weniger leistungsfähig sind als der zweite Typ - die Schlagbohrmaschinen. Wahre Arbeitstiere sind Bohrhämmer: Damit kommen Sie auch spielend durch Beton (siehe K-Tipp 7/2001).
Kaufen Sie sich je ein Grund-Set Stein- und Holzbohrer mit den im Haushalt am häufigsten gebrauchten Bohrdurchmessern 5 sowie 6 und 8. Kosten für beide Sets: je nach Qualität um die 15 Franken.
Drehzahlregel: Je grösser der Bohrerdurchmesser, desto kleiner die Drehzahl. Je härter der Werkstoff, desto kleiner die Drehzahl.
Loch, Dübel und Schraube bilden eine Einheit
- Bei den meisten Dübeln ist auf der Packung und oft auch auf dem Dübel selbst Folgendes angegeben: Dübeldurchmesser, benötigter Bohrerdurchmesser und Durchmesser der passenden Schrauben.
Damit der Dübel hält, was er verspricht
- Faustregel: Dübel ab 8 Millimeter Durchmesser sind sehr schweren Dingen wie Wandschränken vorbehalten.
- Wichtig ist auch die Beschaffenheit der Wand. Machen Sie an einer später verdeckten Stelle eine Probebohrung. Achten Sie auf die Farbe des austretenden Bohrmehls und auf mögliche Hohlräume.
- Rotes und graues Bohrmehl: Ziegelstein und zementgebundene Materialien. Hier reichen normale Dübel.
- Reinweisses Bohrmehl: Gipswand. Für einen sicheren Halt sind überlange Dübel und Schrauben nötig.
- Hohldecken und -wände: Verwenden Sie so genannte Federklapp- oder Kippdübel.
Vorsicht: Nicht zu tiefe Löcher bohren
- Nehmen Sie für die Tiefe des Bohrlochs am Dübel Mass und geben Sie 1 Zentimeter dazu. Der Dübel sitzt am besten, wenn die Schraube im eingedrehten Zustand mit der Spitze durch den Dübel hindurchragt.
Stellen Sie an Ihrer Bohrmaschine den Tiefenanschlag ein. Falls die Maschine keinen solchen hat, markieren Sie die Bohrtiefe mit Farbstift oder Klebeband am Bohrer. Arbeiten Sie mit niedriger Umdrehungszahl.
- Wenn die Wand eine Isolierschicht hat: Versenken Sie den Dübel im dahinter liegenden festen Mauerwerk und benutzen Sie eine entsprechend längere Schraube. Durch eine Probebohrung finden Sie die nötige Bohrtiefe heraus.
Auch Plättli lassen sich löchern
- Arbeiten Sie auf Plättli mit viel Druck, aber ohne Schlagbohrwerk. Verwenden Sie einen Keramik- oder einen ungebrauchten Steinbohrer.
Tipp: Kleben Sie mehrere Schichten raues Klebeband (Abdeckband) auf die Stelle, an der Sie durch das Plättli bohren wollen. So tanzt die Bohrerspitze weniger wild hin und her. Der Trick hilft auch bei anderen glatten und harten Oberflächen.
- Bei sehr glattem Material können Sie den Bohrpunkt auch «ankörnen», indem Sie mit einem Hammer und einem Körner oder Nagel ganz vorsichtig ein kleines Loch in die Oberfläche schlagen.
Vorsicht vor Wasser- und Stromleitungen
- Besorgen Sie sich ein so genanntes Leitungs-Ortungsgerät. Es gibt sie im Fachhandel ab 20 Franken.
Stephan Pfäffli
Akku-Bohrer oder was?
Je nach Arbeit empfiehlt sich eine Schlagbohrmaschine, ein Bohrhammer oder ein Akku-Bohrer.
- Schlagbohrmaschine: Für Gelegenheits-Heimwerker ist dieses Gerät ideal. Damit lässt sich in Holz, Stahl, Mauerwerk und Beton unter Zuschaltung des Schlag- oder Hammerwerks bohren.
- Bohrhammer: Er ist der Schwerarbeiter unter den Bohrgeräten. Wer öfters Beton, Mauern, Kunst- oder Naturstein löchert, ist damit gut bedient.
- Akku-Bohrer: Er ist das Leichtgewicht. Zudem ist er netzunabhängig und deshalb rasch überall einsetzbar. Seine Leistung ist aber dadurch stark eingeschränkt (siehe
K-Tipp 7/2001).