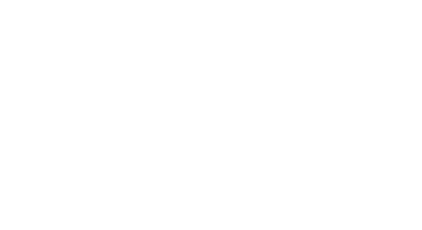«Das Geschäft mit der Angst vor Kalk»
Halten teure Antikalkgeräte, was sie versprechen?<br />
Zumindest die Wirksamkeit von magnetischen Systemen ist nicht erwiesen. Sichern Sie sich daher vor dem Kauf ab.
Inhalt
Haus & Garten 1/2007
14.03.2007
STEFAN CHRISTEN
Sie finden sich noch und noch in den Broschüren von Herstellern: klassische Abbildungen dicker Schichten von Kalkstein auf Leitungsrohren, Ventilen und Brausen. Von Kalk und Rost zerfressene Zuleitungen zur Waschmaschine. Botschaft: Der Schaden ist gross. Der Hiobsbotschaft folgt die gute Nachricht auf dem Fuss - dass es nämlich möglich sei, mit geeigneten Geräten die Kalkkatastrophe zu verhindern.
Abhilfe schaffen sollen sogenannte Antikalk- oder Kalkschutzsysteme. In Haushal...
Sie finden sich noch und noch in den Broschüren von Herstellern: klassische Abbildungen dicker Schichten von Kalkstein auf Leitungsrohren, Ventilen und Brausen. Von Kalk und Rost zerfressene Zuleitungen zur Waschmaschine. Botschaft: Der Schaden ist gross. Der Hiobsbotschaft folgt die gute Nachricht auf dem Fuss - dass es nämlich möglich sei, mit geeigneten Geräten die Kalkkatastrophe zu verhindern.
Abhilfe schaffen sollen sogenannte Antikalk- oder Kalkschutzsysteme. In Haushaltsprospekten, an Messen oder auch von fliegenden Händlern werden solche Systeme als Allerheilmittel gegen Kalkprobleme angeboten. Die Geräte haben allerdings ihren Preis: Je nach Quelle blättert man dafür schnell mehrere Tausend Franken hin. Manch ein Hausbesitzer gerät da ins Sinnieren - wie auch die häufigen Anfragen bei der Hotline des K-Tipp belegen: Lohnt sich diese teure Investition wirklich?
«Oft unnötig und umweltbelastend»
Wasser-Fachmann Robert Haas spricht von einem «Geschäft mit der Angst vor verkalkten Installationen». Haas leitet für den Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) die technische Prüfstelle Wasser in Zürich, die Produkte auf ihre Trinkwassertauglichkeit prüft und zertifiziert - auch sogenannte Wassernachbehandlungsgeräte. Für Leute, «die mit dem Kauf eines solchen Gerätes ihr Gewissen beruhigen möchten», so Haas, hat die unabhängige Fachstelle eine klare Botschaft: «Geräte zur Nachbehandlung von Wasser sind oft unnötig und auch umweltbelastend.»
Die Wasserhärte - das Mass für die Menge gelöstes Kalzium und Magnesium im Wasser - wird in der Schweiz in französischen Härtegraden (fH) angegeben. Erst ab einem Wert von 30 °fH und mehr, also bei hartem Wasser, macht es gemäss Merkblatt des SVGW Sinn, eine Wassernachbehandlung ins Auge zu fassen. Die geologische Wasserhärtekarte der Schweiz (siehe Abbildung) zeigt: Hart ist das Wasser in Gebieten der Südwestschweiz (Waadt), des Mittellandes und der Nordostschweiz. Die Frage nach einem Antikalkgerät stellt sich also nur für einen Teil der Schweizer Bevölkerung.
Nachbarn fragen, ob sie Probleme mit Kalk hatten
Allerdings: Je nach Gemeinde und Region kann die Härte des Wassers stark variieren. Erste Anlaufstelle bei Fragen rund um Wasserhärte und allfällige Gegenmassnahmen ist daher die Wasserversorgung der Wohngemeinde. «Es empfiehlt sich auch, die Nachbarn zu fragen, ob sie wegen Kalkstein Leitungen oder den Boiler vorzeitig ersetzen mussten», so der Rat der Wasser-Fachstelle.
Neben der Wasserhärte haben auch andere Faktoren einen Einfluss: die Art der Hausinstallation (zum Beispiel ein Haushalt mit vielen Duschen), das Material der Rohrleitungen, der Wasserverbrauch - oder die Frage, ob nur das Warmwasser enthärtet werden soll. Auch deshalb sagt der Fachmann: «Es ist für Laien äusserst schwierig und komplex, ein geeignetes Nachbehandlungsverfahren für das Trinkwasser zu finden.»
Grundsätzlich unterscheidet man heute drei Systeme: chemische (Ionenaustauscher), physikalische sowie Geräte auf der Basis von Elektroden und speziellen Harzen (neuere Technologie).
Chemische Wasserenthärtung
Ionenaustauscher arbeiten auf der Basis von Harzen und Salzen. Sie entziehen dem Wasser Kalk: Kalziumionen aus dem Wasser werden gegen Natriumionen des Harzes ausgetauscht.
Für Robert Haas ist unbestritten: «Dieses Verfahren funktioniert zuverlässig.» Aber die chemische Lösung hat Nachteile. Das Wasser wird mit Natrium angereichert. Zudem müssen Ionenaustauscher ständig mit Salz regeneriert werden, was das Abwasser ebenfalls belastet. Und: Das System steht und fällt mit einer regelmässigen, sorgfältigen Wartung. So müssen die Geräte mit einem dauerhaften Desinfektionssystem ausgestattet sein, damit das Harzbett nicht verkeimt. Eine Enthärtungsanlage kann sich zu einem gefährlichen Bakterienherd entwickeln. «Aus Gründen der Hygiene und der Betriebssicherheit sollte mit dem Lieferanten ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden», empfiehlt die Prüfstelle des SVGW. Zu den rund 3500 bis 4000 Franken, die ein Gerät kostet, kommen also noch laufende Betriebskosten. Zu beachten ist: Auch Ionenaustauscher sind erst ab einer Wasserhärte von 30 °fH eine Option. Ausserdem sollte das Wasser nicht unter 12 ° bis 15 °fH enthärtet werden.
Physikalische Wasserbehandlung
Physikalische Kalkstopper sollen mit Hilfe von elektrischen oder magnetischen Feldern die Kalkstruktur verändern und die Verkrustung verhindern. Das heisst: Der Kalk lagert sich nach Angaben der Produzenten nicht mehr an den Rändern der Rohre ab, sondern wird mit dem Wasser ausgeschwemmt.
Zu diesen Gerätetypen zählen Magnete, die in die Rohrleitung eingebaut werden oder rund um die Leitung montiert sind. Bei elektromagnetischen Systemen wird das Magnet mit Ringspulen um die Leitung gewickelt und das Magnetfeld mit Hilfe von Strom erzeugt.
Physikalische Antikalksysteme gibt es bereits seit mehr als einem Jahrhundert. Trotzdem wurde der wissenschaftliche Nachweis für ihre Wirksamkeit bis heute nicht erbracht. «In zahlreichen Untersuchungen konnte nie ein Verfahrenserfolg dieser Geräte unter reproduzierbaren Versuchsbedingungen festgestellt werden», schreibt der Fachverband SVGW. Die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa führte in den Achtzigerjahren einige Versuche mit magnetischen Geräten durch - ebenfalls ohne klares Ergebnis: «Über die Wirksamkeit dieser Geräte ist sich die Fachwelt nicht einig», stellte die Empa fest.
Das Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik der Hochschule für Technik in Rapperswil veröffentlichte vor einem Jahr eine «Checkliste zur Identifikation von technisch wirkungslosen Verfahren und Produkten» (zu finden im Internet unter www.umtec.ch). Darin stellt das Institut fest: «Magnete oder elektromagnetische Impulse haben keinen Einfluss auf die technisch relevanten Eigenschaften von Flüssigkeiten wie Wasser oder Benzin (Stichworte: Wasserentkalkung, Mauerwerkstrockenlegung usw.).»
Immerhin heisst es in einer vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Buwal) herausgegebenen Studie über elektromagnetische Systeme von 1999: Es sei gelungen, «elektromagnetische Felder so zu erzeugen und einzusetzen, dass damit eine krustenvermindernde und im Idealfall eine vollständig krustenverhindernde Wirkung» resultierte. Die Studie warnte freilich vor Verallgemeinerungen. Die deutsche Stiftung Warentest (Stiwa) kam in einer Untersuchung im Jahr 2000 zum Schluss, dass die meisten Systeme mit Magnetfeldern überhaupt nichts bewirken.
Die Preisspanne bei den physikalischen Geräten ist enorm: In Versandkatalogen findet man Antikalkgeräte «mit Magnet-Power» bereits für rund 30 Franken, komplexere Systeme kosten bis zu 2000 Franken. Selbst für den Fachmann sind diese Preisunterschiede «ein Rätsel», so Robert Haas. Und weil bei physikalischen Wasserbehandlungsgeräten so vieles unklar ist, lautet die Empfehlung des Wasser-Fachverbandes: Wer ein solches System kaufen will, sollte sich beim Anbieter unbedingt vertraglich absichern.
Geräte neuerer Technologie
Seit einigen Jahren sind bei den physikalischen Systemen Geräte mit einer neuen Technologie erhältlich. Dabei wird das Wasser an stromführenden Elektroden vorbeigeführt. Es durchfliesst eine Patrone, die mit speziellen Harzen oder Aktivkohle gefüllt ist. So sollen die Kalkpartikel mit dem Wasser abfliessen. Gemäss dem erwähnten Stiwa-Test sind solche Geräte am ehesten wirksam. Ihr Nachteil: Auch hier fallen regelmässige Betriebs- und Wartungskosten an.
Einige Geräte dieser Bauart erfüllen die Anforderungen, die die Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachs (DVGW) definiert hat (das Merkblatt kann für 17 Euro bestellt werden: www.dvgw.de > Service > Regelwerkverzeichnis, Suchbegriff: W 512). Sofern ein Gerät den Nachweis gemäss diesem Prüfverfahren erbracht hat, erteilt der schweizerische Fachverband SVGW dafür ebenfalls die Zertifizierung. «Trotzdem sollte man sich auch bei diesen Systemen vom Hersteller Garantien geben lassen», sagt Robert Haas. «Ich habe schon Geräte gesehen, die trotz DVGW-Nachweis den gewünschten Nutzen nicht erbracht haben.»
SVGW-Zertifizierung sagt nichts über Wirksamkeit
Die technische Prüfstelle des SVGW nimmt übrigens die meisten Wasserbehandlungsgeräte unter die Lupe. Sie verfügen damit über die Zertifizierung des Verbandes. Doch wohlgemerkt: Das SVGW-Zertifikat garantiert lediglich, dass ein Gerät die hygienischen und technischen Anforderungen erfüllt. Über die Wirksamkeit sagt die Zertifizierung nichts aus. «Die Anwendung liegt im Ermessen des Benutzers» - zu diesem Schluss kommt der SVGW bei allen physikalischen Antikalkmethoden, aber auch bei «esoterischen Verfahren», die Händler häufig parallel zu den eigentlichen Entkalkungssystemen anbieten. Die Wirkung solcher «Vitalisierungssysteme», die angeblich das Wasser «beleben», ist durch die Wissenschaft nicht belegt.
Das Fazit: Antikalkgeräte sind teuer und oft überflüssig. Viel günstiger und wohl wirksamer ist der richtige Umgang mit wasserbetriebenen Hausinstallationen und Geräten. Die Tipps zur Verhinderung von Kalkstein finden Sie auf Seite 15.
Mittel gegen Kalk: Die Tipps
Wer einige einfache Regeln beachtet, kann im Haushalt die Ablagerung von Kalk verhindern oder reduzieren.
- Warmwassertemperatur auf 60 Grad Celsius einstellen (nicht tiefer, da sonst die Gefahr von Legionellen-Bakterien besteht).
- Beziehen Sie regelmässig aus allen Wasserhahnen Wasser.
- Für Kaffeemaschinen und Bügeleisen keinen Putzessig verwenden. Er kann Metall- und Kunststoffteile angreifen. Das vom Hersteller empfohlene Entkalkungsmittel verwenden.
- Für Geschirrspülmaschinen sind Entkalkungsmittel überflüssig - sie verkalken nicht, wenn die eingebaute Enthärteranlage regelmässig mit Spezialsalz versorgt wird.
- Waschmaschine: Waschmittel enthalten bereits kalkbindende Mittel. Je härter das Wasser ist, umso mehr Waschmittel ist erforderlich. Dosieren Sie die Menge je nach Wasserhärte in Ihrer Region gemäss den Angaben auf der Verpackung. Auf den Packungen sind die Dosierungsvorschriften angegeben.
- Armaturen, Plättli, Duschwände und Waschbecken nach der Benutzung trockenwischen.
- Sichtbare Kalkspuren auf Armaturen und Fliesen lassen sich am besten mit verdünntem Putzessig entfernen. In hartnäckigen Fällen den Essig eine Zeit lang einwirken lassen.
Was sie bei einem gerätekauf berücksichtigen sollten
- Wasserhärte: Klären Sie ab, wie hart das Wasser in Ihrer Region ist. Die Wasserversorgung der Wohngemeinde kann Ihnen Auskunft geben. Bei einer Wasserhärte unter 30 °fH (Messwert in französischen Härtegraden) ist eine Nachbehandlung ausser für technische Zwecke nicht sinnvoll.
- Systemwahl: Lassen Sie sich vom Verkäufer erklären, auf welchem Verfahren sein Entkalkungssystem beruht. Ionenaustauscher enthärten das Wasser, sind aber wartungsintensiv und belasten die Umwelt. Die Wirksamkeit von physikalischen Systemen ist umstritten. Einige Geräte erfüllen die Anforderungen des deutschen Fachverbandes DVGW. Erkundigen Sie sich nach diesem Wirksamkeitsnachweis.
- Testzeit/Garantie: Wer ein Gerät zur Wassernachbehandlung kaufen will, sollte sich vorher vertraglich absichern. Vereinbaren Sie mit dem Verkäufer eine Testzeit von mindestens 12 Monaten - dies empfiehlt auch der Fachverband SVGW. Lassen Sie sich schriftlich zusichern, dass das Gerät in Ihrem Wasser- und Leitungssystem kalkvermindernd wirkt. Der Kaufvertrag sollte so formuliert sein, dass die Bezahlung erst dann fällig wird, wenn die schriftlich garantierte Wirksamkeit festgestellt ist.
- Rückgaberecht: Pochen Sie auf ein Rückgaberecht für den Fall, dass keine Wirkung festgestellt werden kann - verbunden mit der Zusicherung, dass auch die Montagekosten zurückerstattet und allfällige Kosten für Folgeschäden übernommen werden.
- Referenzen: Holen Sie beim Verkäufer Referenzen aus Ihrem Wasserversorgungsgebiet ein.
Dachorganisation der wasserversorger
Der Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) ist die Dachorganisation von über 100 Gas- und 400 Wasserversorgungsunternehmen. Die Technische Prüfstelle Wasser des SVGW prüft und zertifiziert im Auftrag der Wasserversorgungen alle Produkte, die mit Trinkwasser in Berührung kommen (Armaturen Brausen, Ventile, Rohre, Leitungen, Geschirrspülmaschinen, Wasserbehandlungsgeräte usw.). Die Zertifizierung erfolgt aufgrund von europäischen und eigenen Prüfvorschriften.
Zum Thema Kalkschutzgeräte hat der SVGW verschiedene Merkblätter publiziert, die man im Internet herunterladen kann.
- www.svgw.ch > Produkte > Fachinformationen > Wasser
Merkblatt TPW 2003/2: Trinkwassernachbehandlung beim Konsumenten
Merkblatt TPW 2004/3: Physikalische Wassernachbehandlungsgeräte
Merkblatt TPW 2004/4: Enthärtungsanlagen (Ionenaustauscher)
- Infos zur Wasserhärte liefert auch die SVGW-Webseite
www.trinkwasser.ch > Trinkwasser > Wasserhärte